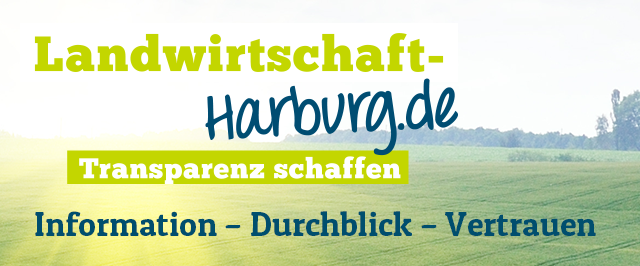Thema des Monats
Mähdrescher
Nun sind sie wieder auf unseren Feldern unterwegs und kaum zu übersehen. Anlass für uns, einen Blick ins Innere eines Mähdreschers zu werfen.
Technik und Leistung moderner Mähdrescher haben sich rasant entwickelt. Neue Maschinen sind randvoll mit elektronischen Kontroll- und Steuerungssystemen. Zudem sind sie immer leistungsstärker geworden und verfügen über Motorleistungen von bis zu 790 PS. Die gröÃten Maschinen arbeiten mit Schneidwerken mit Arbeitsbreiten von bis zu 13,79 Metern. Ihr Korntank, in dem das ausgedroschene Getreide gesammelt wird, fasst bis zu 18.000 Liter. Im Kreis Harburg wären die gröÃten Modelle allerdings Fehl am Platz, weil hier zu viel Rüst- sowie An- und Abfahrtszeit anfällt.
Eine hohe Leistung ist wichtig, da für die Getreideernte nur ein Zeitfenster von wenigen Wochen zur Verfügung steht und je nach Wetterverhältnissen häufig in kurzer Zeit möglichst viel geerntet werden muss. Zudem sind Mähdrescher sehr teuer und müssen deshalb in der Erntezeit gut ausgelastet werden. Ein leistungsstarker Mähdrescher mit aufwändiger Ausstattung kostet heute je nach Modell 300.000 bis 500.000 Euro, die Top-Modelle einzelner Marken bis zu 800.000 Euro. Deshalb investieren meist nur groÃe Ackerbaubetriebe in einen eigenen Drescher. Kleinere Betriebe lassen ihre Bestände meist von Lohnunternehmen dreschen, die den Einsatz teurer Maschinen in Ackerbau und Ernte als Dienstleistung anbieten.
Grundsätzlich funktionieren alle modernen Mähdrescher nach dem gleichen Prinzip. Das Erntegut wird mit dem Schneidwerk geschnitten und eingezogen. Dabei bringt die sogenannte Haspel die Halme des Ernteguts durch eine Drehbewegung in eine optimale Position, damit die Pflanzen am Boden sauber abgeschnitten und zur Einzugstrommel geführt werden können. Die schnell rotierende Einzugstrommel führt Halme und Ãhren zum mittig gelegenen Einzugskanal der Maschine.
Ãber Einzugsketten gelangt das Erntegut in das Innere des Mähdreschers und wird zur Dreschtrommel befördert. Die Dreschtrommel besteht aus sich schnell drehenden Einzeltrommeln und dem gegenüberliegenden Dreschkorb. Halme und Ãhren werden von den Trommeln mit hoher Geschwindigkeit über den Dreschkorb geführt und ein GroÃteil der Körner dabei ausgeschlagen (etwa 90 Prozent). Das Stroh mit den restlichen Körnern wird weiterbefördert zum sogenannten Schüttler.
Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Während der Rotor einen höheren Durchsatz und damit mehr Flächenleistung ermöglicht (bis zu 100 Tonnen Getreide pro Stunde auf sehr groÃen Schlägen; nicht in WL), liefern Drescher mit Schüttlern bessere Strohqualitäten, weil das Stroh schonender ausgedroschen wird.
Eine gute Strohqualität ist vor allem für tierhaltende Betriebe wichtig, die das Material als Einstreu nutzen. Deshalb kommen hier in der Regel strohschonende Schüttlermaschinen zum Einsatz. Das ausgedroschene Stroh wird ohne weitere Bearbeitung zurück auf das Feld befördert und anschlieÃend mit einer Ballenpresse zu Strohballen gepresst.
Bei reinen Ackerbaubetrieben ohne Tierhaltung bleibt das Stroh dagegen häufig als organisches Material auf der Fläche. Durch den Verrottungsprozess verbessert es das Bodenleben und fördert den Humusaufbau. Um das Stroh in den Boden einarbeiten zu können, wird beim Dreschen ein Häckselaggregat am hinteren Auswurfkanals des Mähdreschers zugeschaltet, über das die meisten Mähdrescher verfügen. Es schneidet das anfallende Stroh in wenige Zentimeter lange Häcksel, die über die gesamte Schnittbreite gleichmäÃig auf der Fläche verteilt werden.
Das geerntete und vorgereinigte Korn sammelt sich im Korntank des Mähdreschers. Ist der Tank voll, wird der Inhalt über ein seitlich ausklappbares Ãberladerohr auf einen Anhänger oder Lkw befördert.
Ausblick auf das nächste Thema des Monats